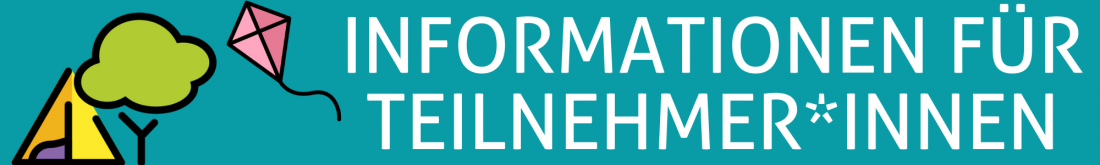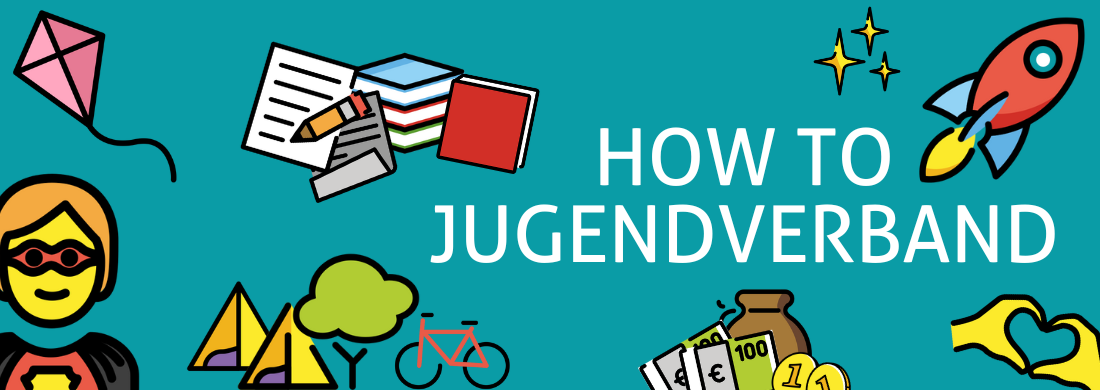
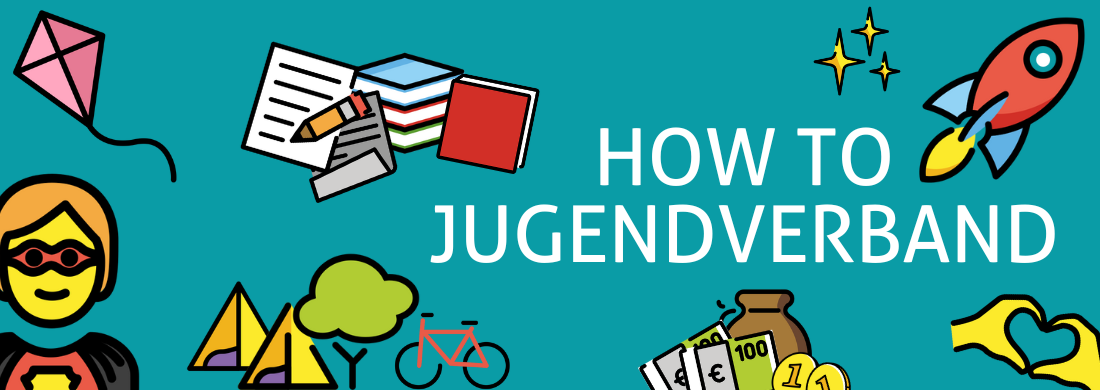
HOW TO JUGENDVERBAND: Infos für Teilnehmer*innen, Hinweise für neue Aktive und Wissen für Vorstände
Wenn eine Person neu im Jugendverband ist, ist vieles neu und unbekannt. Aber auch Personen, die schon länger im Verband sind, können sich durch eine neue Position, zum Beispiel im Vorstand, noch einmal ganz „neu“ fühlen. Diese Infosammlung richtet sich vor allem an Engagierte in Jugendverbänden, die sich mit der Frage beschäftigen, wie ein Einstieg in den Verband, aber auch in eine neue Funktion gut begleitet werden kann.
Welche Informationen über unseren Jugendverband und unsere Angebote wollen wir jungen Menschen mitgeben, die an unseren Angeboten teilnehmen? Wenn Kinder und Jugendliche zum ersten Mal an einem Angebot im Verband teilnehmen, haben sie vielleicht Fragen, was Jugendverbände sind und was sie machen. Möglicherweise wollen auch die Eltern bestimmte Dinge wissen. Hier gibt es Antworten zu den folgenden Fragen:
- Was sind Jugendverbände?
Jugendverbände sind Vereine, die von jungen Menschen gegründet wurden.
In Jugendverbänden kommen junge Menschen zusammen. Dort organisieren sie gemeinsam Angebote für andere junge Menschen. Dazu gehören zum Beispiel Ferienfahrten, Ausflüge, Workshops und vieles mehr. In Jugendverbänden gestalten Kinder und Jugendliche ihre Freizeit gemeinsam mit anderen jungen Menschen.
Das Besondere an Jugendverbänden ist, dass die Kinder und Jugendlichen selbst bestimmen, was sie machen wollen. Sie denken sich die Angebote selber aus und setzen sie dann um. In Jugendverbänden haben sich junge Menschen zusammengeschlossen, die sich für die gleichen Dinge interessieren. Gemeinsam setzen sie sich für andere Menschen ein.
Um mitmachen zu können, muss man nicht Mitglied im Verband sein.
Jugendverbände sind Orte, an denen Kinder und Jugendliche
- sich selbst organisieren,
- sich freiwillig engagieren,
- ihre Freizeit selbst gestalten,
- demokratische mitbestimmen,
- lernen, ihre Interessen zu formulieren,
- sich in politische und gesellschaftliche Prozesse einbringen, wenn sie das wollen.
Der Landesjugendring Berlin hat eine Informationsbroschüre zur Jugendverbandsarbeit in Berlin erstellt. Sie ist in 13 Sprachen und kostenlos erhältlich.
- Was machen Jugendverbände?
Jugendverbände machen das ganze Jahr über Angebote für Kinder und Jugendliche:
- Sie betreuen Kinder- und Jugendgruppen.
- Sie bieten Kinder- und Jugendreisen an.
- Sie betreiben Jugendzentren, Jugendclubs oder Jugendcafés. Dort können sich Kinder und Jugendliche treffen und kennenlernen.
- Sie bilden Jugendleiter*innen aus.
- Sie treffen andere Jugendliche im Ausland.
- Sie engagieren sich politisch.
- Sie setzen sich für die Umwelt ein.
- Sie machen Kulturarbeit.
- Sie machen Sportangebote.
- Sie bieten Seminare und Bildungsarbeit an.
Im Terminkalender des Landesjugendring Berlin tragen viele Berliner Jugendverbände ihre Angebote ein. Natürlich informieren die Berliner Jugendverbände auch auf ihren Websites über ihre Angebote.
- Welche Jugendverbände gibt es?
Im Landesjugendring Berlin sind die Berliner Jugendverbände zusammengeschlossen. Zurzeit sind 37 Jugendverbände und Bezirksjugendringe Mitglied im Landesjugendring Berlin.
Es gibt
- konfessionelle Verbände (z.B. die Evangelische Jugend, der Bund der Deutschen Katholischen Jugend oder die Alevitische Jugend)
- die Sportjugend
- die Jugendverbände von Hilfsorganisationen (z. B. die THW-Jugend, die Jugendfeuerwehr oder das Jugendrotkreuz)
- Pfadfinder*innen-Verbände
- Jugendverbände, die sich für den Umwelt- und Naturschutz einsetzen (z. B. die BUNDjugend)
- Jugendverbände, die vor allem international arbeiten oder in denen sich vor allem Jugendliche mit Migrationshintergrund zusammengeschlossen haben (z. B. djo-Regenbogen Berlin oder die Junge Europäische Bewegung)
- humanistische oder politische Jugendverbände (z. B. die Sozialistische Jugend Deutschlands – Die Falken, die Jungen Humanist*innen, die JungdemokratInnen/Junge Linke oder die Naturfreundejugend)
- außerdem gibt es zum Beispiel das Jugendnetzwerk Lambda, das sich für schwule, lesbische, bi-, trans*, inter*, queere (LSBTIQ*) Jugendliche in Berlin und Brandenburg einsetzt, oder die Jugendpresse Berlin-Brandenburg oder jubel³ mit Gebärdensprache e.V. und viele andere.
- Wer sind die Menschen, die in den Jugendverbänden Angebote machen?
Viele Menschen in der Jugendarbeit sind ehrenamtlich tätig. Vor allem in Jugendverbänden sind das junge Menschen, die sich bereits seit vielen Jahren in ihrem Verband freiwillig engagieren. Andere Personen, die in der Jugendarbeit tätig sind, sind für diese Arbeit ausgebildet und werden dafür bezahlt. In der Regel haben sie dafür studiert oder haben eine Ausbildung im sozialen Bereich gemacht. Neben hauptamtlich tätigen Personen unterstützen sehr häufig Honorarkräfte die Arbeit der Verbände.
Die Leute, die in den Verbänden arbeiten, kümmern sich um alles vor Ort. Kinder und Jugendliche können einfach vorbeikommen und bei den Angeboten mitmachen.
Viele Ehrenamtliche in Jugendverbänden wurden in Juleica-Schulungen zu Jugendleiter*innen ausgebildet. Juleica steht für Jugendleiter*innen-Card. In einer Juleica-Schulung lernen junge Menschen, wie man mit Kinder- und Jugendgruppen am besten umgeht. Die Schulung wird von vielen Jugendverbänden angeboten. Die Juleica bekommt man nur, wenn man an einer 40-stündigen Ausbildung zu pädagogischen und rechtlichen Inhalten teilgenommen hat, einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht hat und sich ehrenamtlich in einem Jugendverband engagiert.
- Woher bekommen Jugendverbände Geld?
Die Arbeit von Jugendverbänden hat eine gesetzliche Grundlage. Sie ist im Sozialgesetzbuch VIII im § 12 geregelt.
Junge Menschen haben ein Recht auf Angebote, die sich nach ihren Interessen richten und die sie selber gestalten können. Deshalb bekommen Jugendverbände, in denen junge Menschen zusammenkommen, öffentliche Fördermittel, also Geld vom Staat.
Jugendverbände finanzieren ihre Arbeit ansonsten durch Spenden. In einigen Verbänden zahlen die Mitglieder auch einen Mitgliedsbeitrag. Einige Angebote wie zum Beispiel Ferienfreizeiten kosten etwas. Viele Jugendverbände bieten aber auch Ermäßigungen an. Sehr viele Angebote in Jugendverbänden sind jedoch kostenlos und finden regelmäßig statt.
- Was gibt es ganz speziell über deinen Verband zu wissen?
Die hier zusammengefassten „Basis-Infos“ über Jugendverbände und Jugendverbandsarbeit können dabei unterstützen, jungen Menschen (oder vielleicht auch ihren Eltern) einen kurzen Einblick zu vergeben, was Jugendverbände sind und was sie machen.
Natürlich gibt es über jeden einzelnen Jugendverband noch viel mehr zu erzählen. Was ist interessant für die jungen Menschen, die an euren Angeboten teilnehmen? Stehen alle Infos zu euch bereits auf eurer Website oder sind über andere Kanäle schnell zugänglich? Wer kann in eurem Verband gut Fragen zu euch als Verband, euren Zielen und Inhalten, eurer Arbeit und vielleicht auch eurer Verbandsstruktur beantworten?
Um die Kontaktaufnahme für Interessierte einfacher zu machen, kann es hilfreich sein, konkrete Ansprechpersonen zu nennen, oder andere Kontaktmöglichkeiten anzubieten, zum Beispiel eine Mailadresse, einen Instagram-Account oder ein regelmäßiges Format zum Kennenlernen.
Der Abschnitt "Informationen für Teilnehmer*innen" zum Download:
Wie können wir (neue) ehrenamtlich Engagierte gut in unserem Verband unterstützen? Jemand ist auf euch zugekommen und hat gesagt, dass er*sie gerne aktiv mitmachen möchte? Super! Vielleicht kennt die Person schon andere Aktive aus eurem Verband, weil sie bereits an Angeboten teilgenommen hat. Möglicherweise ist sie aber auch gerade nach Berlin gekommen und ganz neu dabei. Wie auch immer: Ein guter Einstieg hilft, dass Aktive auch längerfristig dabei bleiben.
- Wie können erfahrene Engagierte neue Aktive beim Einstieg unterstützen?
Ein guter Einstieg hilft, dass Aktive auch längerfristig dabei bleiben. Diesen Einstieg könnt ihr begleiten:
- Neue Ehrenamtliche aktiv willkommen heißen
Zeigt, dass ihr euch darüber freut, dass die Person Lust hat, sich aktiv ins Verbandsleben einzubringen. - Orientierung schaffen
Wie „funktioniert“ euer Verband? Welche regelmäßigen Treffen gibt es? Wo kann man weitere Aktive kennenlernen? Gibt es feste Ansprechpersonen? Gibt es Termine, die man sich merken kann/sollte? - Feste Ansprechpersonen
Ein Verbandsmitglied wird als feste Ansprechperson benannt. Sie kann Fragen beantworten, andere Personen aus dem Verband vorstellen, auf weitere Treffen und Termine hinweisen und dabei unterstützen, Anschluss im Verband zu finden. - Alles ist (vielleicht) neu
Geht nicht von Vorwissen aus. Schafft Raum für Fragen. Seid selbst achtsam für Selbstverständliches: Sind alle „Vokabeln“, alle Abkürzungen, etc. bekannt? Gab es die Gelegenheit für einen Überblick über die Aktiven und ihre Aufgaben? - Begleitung in der Anfangszeit
Gibt es Ansprechpersonen im Sinne von Mentor*innen, Buddys oder Pat*innen, die bei allen möglichen Fragen in der Anfangszeit erreichbar sind? - Nicht gleich alle Verantwortung übertragen
Lernt euch kennen. Fragt zum Beispiel aktiv nach den Stärken und Vorstellungen der Person. Stellt euch selbst vor: Wo liegen eure Stärken, was macht ihr besonders gerne, welche Aufgaben übernehmt ihr deshalb? Manche Menschen springen gerne gleich hinein, andere tasten sich erstmal heran. Beides ist in Ordnung. Schaut miteinander, was individuell passt. - Gemeinschaft fördern
Gerade wenn eine neue Person dazukommt, ist es eine gute Gelegenheit zu schauen, ob es genügend Formate für gemeinsame Treffen gibt, die nur dazu da sind, um Zeit miteinander zu verbringen. - Spaß haben
Bei aller Verantwortung - alle sollen Spaß haben! Achtet darauf, wie es allen geht. Wie sind die Aufgaben verteilt? Kann jede*r mitreden? Können sich alle so viel einbringen, wie sie mögen?
- Neue Ehrenamtliche aktiv willkommen heißen
- Was sollten neue Ehrenamtliche unbedingt wissen, bevor sie ein Angebot machen?
Zum ersten Mal Teamer*in bei einer Ferienfreizeit, Begleitung bei einem Ausflug oder Leitung einer Gruppenstunde? Das kann ganz schön aufregend sein. Eine gute Vorbereitung kann für alle Beteiligten Sicherheit bringen. Und letztlich gibt es auch Dinge, die Aktive, die ein Angebot machen und leiten, wissen müssen.
- Rechtliche Grundlagen
Sie sind ein Teil der Juleica-Schulung, aber natürlich können immer wieder Unsicherheiten auftreten oder es besteht Nachholbedarf. Stellt sicher, dass eure Aktiven gut Bescheid wissen, worauf sie zu achten haben und was ihre Pflichten sind. Hilfreich ist der Rechtsratgeber vom Landesjugendring, den ihr bei uns bestellen könnt. - Kinder- und Jugendschutz
Die meisten Jugendverbände haben ein Schutzkonzept, in dem klar dargestellt ist, was bei einem (Verdachts-)Fall von Kindeswohlgefährdung zu tun ist. Ein Schutzkonzept beinhaltet sowohl Präventionsmaßnahmen als auch einen aufgeschlüsselten Interventionsprozess. Vor allem sind auch Ansprechpersonen und die ersten Schritte zur Intervention klar benannt und geben den Ehrenamtlichen Sicherheit. Das Schutzkonzept müssen alle Aktiven kennen! Die Broschüre „Kinder- und Jugendschutz in Berlin“ des Landesjugendring informiert zum Thema und beinhaltet auch Hinweise zur Entwicklung eines Schutzkonzepts. - Erweitertes Führungszeugnis
In eurem Jugendverband werdet ihr eine Regelung haben, welche Personen ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen müssen. Alle, die in der Kinder- und Jugendhilfe haupt- oder nebenberuflich tätig sind, sind dazu verpflichtet. Ehrenamtliche können dazu auch verpflichtet sein, allerdings ist die Pflicht abhängig von der Art, Intensität und Dauer des Kontakts zu Kindern und Jugendlichen. Ehrenamtliche erhalten das Führungszeugnis kostenlos.
Der Landesjugendring informiert unter "Kinderschutz" ausführlich zum Thema, insbesondere zur Frage, wie Jugendverbände Schutzkonzepte entwickeln können. Dort gibt es auch Infos zu Führungszeugnissen sowie eine Textvorlage für Jugendverbände, um Gebührenfreiheit für das erweiterte Führungszeugnis zu beantragen.
- Rechtliche Grundlagen
- Juleica-Schulung - da lernst du (fast) alles!
Juleica steht für Jugendleiter*innen-Card. Die Juleica ist ein bundesweit einheitlicher Ausweis für ehrenamtlich Engagierte in der Jugendarbeit. Alle Jugendleiter*innen, die erfolgreich an einer Juleica-Schulung teilgenommen haben, die dauerhaft ehrenamtlich engagiert sind und einen aktuellen Erste-Hilfe-Kurs besucht haben, erhalten die Karte als Legitimation und als Nachweis ihrer Qualifikation.
Eine Juleica-Schulung dauert mindestens 40 Stunden. Wer erfolgreich an einer Schulung teilgenommen hat, kennt sich mit rechtlichen Aspekten und Pflichten aus, weiß wie eine Gruppe funktioniert, hat praktische Methoden gelernt und sich mit Prävention und Vielfalt auseinandergesetzt. Die Schulung wird von vielen Jugendverbänden angeboten.
- Wie können wir neue Engagierte noch unterstützen?
Neue (und auch schon länger) Engagierte könnt ihr auf unterschiedliche Arten unterstützen: Ihr spart ihnen viel Zeit, wenn ihr Materialien bereitstellt. Fortbildungen und ähnliche Angebote machen Spaß und können inspirierend für die Arbeit im Verband sein. Und transparente Strukturen und feste Ansprechpersonen schaffen Sicherheit.
- Materialienpool
Als Jugendverband habt ihr ein enormes Wissen angesammelt. Ihr kennt euch aus in Methoden, habt schon viele Seminare und vielleicht auch Juleica-Schulungen angeboten, habt eine riesige Sammlung an Ideen für die Gruppenstunden und wisst, wo eure Ausflüge und Fahrten hingehen können. Lasst die neuen Engagierten von diesem Wissen profitieren! Vielleicht ist der Einstieg von neuen Engagierten im Verband eine gute Gelegenheit, dieses Wissen zusammenzutragen - Fortbildungen, Workshops & Seminare
Zu vielen Themen, die relevant für eure Arbeit im Verband sind, gibt es über das ganze Jahr verschiedene Fortbildungsangebote vom Landesjugendring und von Jugendverbänden, um euer Wissen zu vertiefen oder zu erweitern. Informationen zu Angeboten findet ihr hier. Auch der Landesjugendring Brandenburg bietet Fortbildungen an. - Transparente Strukturen im Verband und feste Ansprechpersonen
Wer hilft mir, wenn etwas schief geht, wenn wir als Gruppe unterwegs sind? An wen wende ich mich, wenn ich glaube, dass bei einem Kind „etwas nicht stimmt“? Wen frage ich nach Materialien? Und wie erfahre ich von den Treffen und Terminen, die mich interessieren oder wichtig für mich sind? Gebt den neuen Aktiven eine Orientierung, wer bei euch wofür zuständig ist - und sorgt am besten auch direkt für ein persönliches Kennenlernen. Das erleichtert das Fragen, wenn die konkrete Situation da ist. - Kommunikationskultur und Fehlertoleranz
Macht deutlich, dass Fehler erlaubt sind und dazugehören. Findet einen Weg, um über Fehler zu sprechen, der für möglichst alle passt. Achtet auf regelmäßiges Feedback, schafft Raum für Kritik und Reflexion und vor allem für kontinuierlichen Austausch.
- Materialienpool
- Wie können wir unseren Ehrenamtlichen Wertschätzung zeigen?
Ehrenamtlich Aktive sind der Grundpfeiler der Jugendverbandsarbeit, ohne sie gäbe es keines der vielen Angebote, die Jugendverbände machen. Daher ist es wichtig, den Engagierten immer wieder Wertschätzung zu zeigen. Das geht auf unterschiedliche Weise:
- Unterstützt sie kontinuierlich in ihrem Engagement. Versorgt sie mit Materialien für die Angebote. Schafft Formate, um die Vorbereitung der Angebote zu erleichtern. Schaut, wie ihr für ein gutes Zeitmanagement im Verband sorgen könnt.
- Sprecht regelmäßig über (Un-)Zufriedenheiten. Was läuft gut? Was lässt sich verbessern? Wie stellen wir sicher, dass es allen gut geht, dass alle das Gefühl haben, dabei zu sein? Auch wenn es keine Unzufriedenheiten gibt: Nehmt euch die Zeit, auch das regelmäßig auszuwerten und zu loben, was gut läuft.
- Was ist, wenn die Motivation allein nicht reicht? Nicht allen ist es - aufgrund persönlicher Verpflichtungen, Lohnarbeit und anderer Dinge - möglich, sich in dem Ausmaß zu engagieren, wie sie mögen oder es die Angebote erfordern. Habt ihr dafür ein offenes Ohr? Gibt es Strategien? Gibt es möglicherweise auch Aufwandsentschädigungen, falls die Lohnarbeit zu viel Raum einnehmen muss?
- Schafft Raum zur Weiterentwicklung: Fort- und Weiterbildungen sind inspirierend, qualifizierend und motivierend. Für die Engagierten und den ganzen Verband.
- Sagt ganz deutlich DANKE. Mit einem großen Picknick, einer Party, einem Kinoabend. Und dazwischen auch.
- Schaut gemeinsam, welche Vergünstigungen eure Engagierten darüber nutzen können. Die Juleica ist der Ehrenamtskarte gleichgestellt. Zum Beispiel kann man mit der Ehrenamtskarte den Ermäßigungstarif in allen Berliner Bädern in Anspruch nehmen, oder bei den Angeboten der Berliner Volkshochschulen, die dann nur die Hälfte kosten.
Der Abschnitt "Engagierte unterstützen" zum Download:
Was gehört zur Vorstandsarbeit? Und wie gelingt neuen Mitgliedern ein guter Einstieg? Als Mitglied des Vorstands trägt man Verantwortung für den gesamten Verband. Gleichzeitig bietet diese Aufgabe die Chance, interessante Projekte zu gestalten und umzusetzen, zahlreiche Menschen kennenzulernen und die Anliegen sowie Interessen der Mitglieder zu vertreten. Die Vorstandsarbeit erfordert mitunter viel Zeit und Einsatz. Doch mit einem durchdachten Plan, klaren (Verbands-)Strukturen und einer ausgewogenen Aufgabenverteilung kann der Vorstand effizient und erfolgreich arbeiten.
- Was ist ein Vorstand und was macht er?
Der Vorstand trägt die Verantwortung für den Jugendverband. Er wird von den Mitgliedern bei einer Mitgliederversammlung gewählt. In der Satzung eines Verbands ist u.a. geregelt,
- wie viele Personen dem Vorstand angehören müssen,
- für wie lange der Vorstand gewählt wird,
- wie der Verband rechtsgeschäftlich vertreten wird,
- wie oft der Vorstand tagt und in welcher Form.
Zu den Aufgaben des Vorstands gehört,
- die Ziele umzusetzen, die die Mitgliederversammlung für den Verband beschlossen hat,
- langfristig zu planen, wohin sich der Verband entwickeln soll,
- für die Organisation des Verbands zu sorgen (siehe auch „Pflichten des Vorstands“),
- die Verbandsarbeit zu koordinieren,
- den Verband nach außen zu vertreten.
Wenn der Jugendverband eine Geschäftsstelle hat, gehört es außerdem zu den Aufgaben der Vorstandsmitglieder, Arbeitgeber*innen zu sein.
- Was gehört zu den Pflichten des Vorstands?
Welche Pflichten ein Vorstand hat, ist von Verband zu Verband unterschiedlich und in der jeweiligen Satzung geregelt. Üblicherweise gehören dazu:
- Rechtliche Verantwortung
Wird die Satzung eingehalten? Werden bei den Tätigkeiten und Maßnahmen des Verbands andere rechtliche Regelungen eingehalten, bspw. beim Datenschutz, bei Steuerfragen oder beim Aufsichtsrecht? - Finanzielle Verantwortung
Hier geht es um die Haushaltsplanung und natürlich auch deren Abrechnung. Außerdem muss der Vorstand sicherstellen, dass die Mittel ordnungsgemäß eingesetzt werden und die jeweiligen Förderrichtlinien eingehalten werden. - Organisatorische Aufgaben
Einberufung von Sitzungen und Mitglieder-versammlungen. - Kommunikation und Vertretung nach außen
Der Vorstand muss sowohl nach innen mit seinen Mitgliedern kommunizieren als auch nach außen, indem er den Verband, seine Inhalte und die Interessen seiner Mitglieder vertritt.
Ein klarer Plan hilft, dass ihr alle Aufgaben im Blick habt und die Arbeit gut im Vorstand verteilt wird.
- Rechtliche Verantwortung
- Wie kommen wir als Vorstand gut ins Arbeiten?
Teil des Vorstands zu sein bedeutet, für den gesamten Verband Verantwortung zu übernehmen. Es bedeutet aber auch spannende Inhalte zu entwickeln und umzusetzen, viele Menschen zu treffen und die Interessen und Themen der Mitglieder zu vertreten. Vorstandsarbeit kann viel Zeit und Engagement verlangen. Aber ein guter Plan, klare (Verbands-)Strukturen und eine faire Aufgabenverteilung unterstützen einen Vorstand dabei, gut und effizient arbeiten zu können. Diese Punkte können euch helfen:
- Aufgaben verteilen: Wer übernimmt was? Klare Rollen verhindern Chaos und schützen euch davor, Aufgaben zu vergessen oder doppelt umzusetzen.
- Regelmäßige Treffen: Vielleicht schafft ihr es, feste Termine für eure Sitzungen zu verabreden. Das hilft euch, vor allem bei längerfristigen Projekten, den Überblick zu behalten.
- Transparenz schaffen: Alle Mitglieder des Vorstands sollten Zugang zu Informationen und Protokollen haben.
- Feedback geben: Sprecht offen über Erfolge und Herausforderungen.
Eine Vorstandsklausur kann den gemeinsamen Start unterstützen. Nehmt euch dabei Zeit, damit ihr sowohl für Organisatorisches als auch für Inhalte und Ziele genügend Raum habt. Wenn es in eurem Verband eine Geschäftsstelle gibt, dann ladet sie am besten zumindest zu einem Teil eurer Klausur ein. Oft sind die Mitarbeiter*innen in der Geschäftsstelle auch so etwas wie das „Gedächtnis des Verbands“. Die Erfahrungen der Mitarbeiter*innen sind oft eine wichtige Unterstützung für die Arbeit des Vorstands. Eine gute, transparente Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Geschäftsstelle braucht auch Vorbereitung und Absprachen.
- Der Vorstand als Arbeitgeber: Aufgaben & Pflichten
Wenn euer Verband eine Geschäftsstelle hat, seid ihr als Vorstandsmitglieder auch Arbeitgeber*innen und dementsprechend Vorgesetzte für eure hauptamtlichen Mitarbeiter*innen. Das bringt natürlich viele Anforderungen mit sich. Hier ist ein Überblick darüber, was dazu gehört. Aber bitte beachtet: Dieser Überblick ist nicht abschließend!
Fürsorgepflicht
- Als Arbeitgeber*innen tragt ihr die Verantwortung für das Wohlergehen der Mitarbeiter*innen (physisch, psychisch und rechtlich). Das Arbeitsschutzgesetz ist ein zentraler Bestandteil, aber nicht der einzige. Die Fürsorgepflicht umfasst außerdem den Schutz der Persönlichkeit (respektvoller Umgang, Schutz vor Diskriminierung und Mobbing, Datenschutz), den Schutz vor Überlastung und die gerechte Behandlung aller Mitarbeiter*innen.
Arbeitsrechtliche Aufgaben und Pflichten
- Einstellung von Mitarbeiter*innen: Arbeitsverträge müssen schriftlich abgefasst und rechtssicher formuliert sein (z. B. Regelungen zu Arbeitszeit, Vergütung, Urlaub, Probezeit). Die Gleichbehandlungspflicht ist zu beachten (AGG – Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz).
- Kündigung: Kündigungen müssen schriftlich erfolgen und sich an gesetzliche Regelungen halten (z. B. Kündigungsfristen, Kündigungsschutz; ggf. sind zusätzliche Schutzvorschriften zu beachten). Falls es einen Betriebsrat gibt, muss er hinzugezogen werden.
Arbeitsschutz und Gesundheit
- Arbeitsschutzmaßnahmen: Ihr müsst Sorge dafür tragen, dass eure Mitarbeiter*innen keinen Gefahren ausgesetzt sind und ihnen ein sicherer und gut ausgestatteter Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Alles dazu ist im Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) geregelt, dass ihr einhalten müsst. Ihr müsst außerdem die Regelungen zur Arbeitszeit einhalten (Arbeitszeitgesetz, ArbZG).
- Unfallverhütung und Erste Hilfe: Die Mitarbeiter*innen müssen bei der Berufsgenossenschaft angemeldet werden. In der Geschäftsstelle muss es Ersthelfer*innen geben.
Dienst- und Fachaufsicht
- Dienstaufsicht: Das bedeutet, dass ihr sicherstellen müsst, ob die Mitarbeiter*innen ihre vertraglichen Pflichten erfüllen (z. B. Arbeitszeit, Zielerreichung). Außerdem gehört dazu die Klärung und Regelung von Konflikten im Arbeitsumfeld.
- Fachaufsicht: Das bedeutet, dass ihr die Verantwortung für die inhaltliche Qualität der Arbeit tragt. Ihr stellt zum Beispiel sicher, dass die Arbeit im Sinne der Verbandsziele umgesetzt wird.
Sozialversicherung und Steuerrecht
- Anmeldung zur Sozialversicherung: Als Arbeitgeber müsst ihr eure Mitarbeiter*innen bei der Krankenkasse registrieren. Natürlich müsst ihr Sozialversicherungsbeiträge (Renten-, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosenversicherung) abführen sowie die Lohnsteuer an das Finanzamt.
- Meldungen an Behörden: Ihr müsst die Arbeitsagentur informieren, wenn neue Beschäftigte eingestellt werden (Meldepflicht).
Mitbestimmung und Vereinbarung interner Regeln
- Mitbestimmung: Wenn es bei euch einen Betriebsrat gibt, muss dieser bei bestimmten Entscheidungen (zum Beispiel bei der Arbeitsplatzgestaltung, Homeoffice-Regelungen) eingebunden werden. Was alles dazu gehört, regelt das Betriebsverfassungsgesetz. Sollte es keinen Betriebsrat geben, ist es natürlich absolut sinnvoll, die Mitarbeiter*innen bei bestimmten betrieblichen Entscheidungen zu beteiligen und ihre Mitbestimmung zu fördern.
- Vereinbarung von Arbeitszeitregelungen, Datenschutz und anderem: Das regelt ihr in eurer Betriebsordnung. Klare Formulierungen sind hilfreich, um Missverständnisse und Konflikte zu vermeiden.
Fortbildung und Weiterbildung
- Stellt sicher, dass Mitarbeiter*innen an Fort- und Weiterbildungen teilnehmen und sich weiterqualifizieren können.
Es ist anspruchsvoll, Arbeitgeber*in zu sein, keine Frage. Aber es gibt auch viel Unterstützung. Die Landesjugendringe Berlin und Brandenburg machen regelmäßig Fortbildungen zum Thema. Sicher sind erfahrene Jugendverbände auch gerne ansprechbar für eure Fragen. Es gibt auch regelmäßig Seminare der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) zu diesem Thema.
- Personalführung: Wie ist man Chef*in?
Natürlich gehören aber auch noch andere Kompetenzen und Aufgaben dazu, wenn ihr eure Rolle als Chef*innen gut ausfüllen wollt. Dazu gehören unter anderem diese Dinge:
- Sich der Verantwortung für die Mitarbeiter*innen bewusst sein und auf das eigene Handeln und Verhalten achten, vor allem authentisch, zuverlässig und respektvoll handeln.
- Anerkennung und Wertschätzung zeigen. Gleichbehandlung aller Mitarbeiter*innen sicherstellen.
- Aufgaben klar und verständlich formulieren und vor allem auch abgeben. Transparente und klare Strukturen im Verband schaffen.
- Kommunikation im Verband pflegen: regelmäßige Gespräche, klare Formulierung von Aufgaben und offene Ohren für die Anliegen der Mitarbeiter*innen.
- Möglichkeiten einrichten, um Unzufriedenheiten und Beschwerden zu äußern.
Regelmäßige Gespräche mit den Mitarbeiter*innen sind nicht zwingend vorgeschrieben, außer sie sind in Betriebsvereinbarungen, Tarifverträgen oder im individuellen Arbeitsvertrag festgelegt. Es empfiehlt sich aber unbedingt aus arbeitsrechtlicher und organisatorischer Sicht, Mitarbeiter*innengespräche durchzuführen. Zum einen könnt ihr so eure Fürsorgepflicht als Arbeitgeber*innen besser erfüllen, zum anderen trägt eine gute und offene Kommunikation zur Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen bei.
Ein Mitarbeiter*innengespräch kann beispielsweise so aufgebaut sein:- Gesprächseinstieg
- Rückblick und Feedback: Aktuelle Projekte & Ergebnisse, Zielerreichung & Erfolge, Zufriedenheit und Wertschätzung äußern
- Situation am Arbeitsplatz: Zufriedenheiten & Unzufriedenheiten, qualitative & quantitative Arbeitsbelastung, Zusammenarbeit, Ausstattung des Arbeitsplatzes
- Ausblick und Ziele: Aufgabenplanung, Veränderungen, nächste Ziele
- Perspektiven und Wünsche: Weiterbildungsbedarf, berufliche Perspektiven
- Gesprächsabschluss
- Vorstandswechsel: Wie geben wir Wissen weiter?
Im besten Fall wechselt mit der nächsten Wahl nicht gleich der gesamte Vorstand. Aber auch, wenn nur einige Personen im Vorstand wechseln: Damit die Vorstandsarbeit reibungslos weiterlaufen kann ist eine gute Übergabe besonders wichtig. Und die ist vor allem dann möglich, wenn es im Verband gute Formate zum Speichern von eurem Wissen gibt – und dem eurer Vorgänger*innen und Nachfolger*innen.
- Ablagesysteme: Ob Cloud oder andere Formate – ein Verband braucht mindestens einen Ort, an dem sämtliche Informationen hinterlegt sind.
- Persönliche Übergabe: Im besten Fall ist ein gemeinsames Treffen zwischen altem und neuem Vorstand möglich für eine persönliche Übergabe. Dabei geht es nicht nur um die Weitergabe von Informationen, sondern auch um viele andere Fragen, deren Antworten nicht dokumentiert sind. Zum Beispiel: „Wie ging es dir, als du neu im Vorstand warst?“
- Onboarding: Nehmt euch viel Zeit, um neue Vorstandsmitglieder einzuarbeiten. Einige Ideen dazu findet ihr im nächsten Abschnitt.
Hat euer Verband eine Geschäftsstelle? Dann ist es sinnvoll gemeinsam zu überlegen, wie die Geschäftsstelle in der Erstellung und Pflege des Wissensspeichers involviert ist. Und nicht vergessen: Das Wissen der Geschäftsstelle gehört natürlich auch dazu!
- Neu im Vorstand: Wie gelingt ein guter Einstieg?
Der Start in die Vorstandsarbeit ist aufregend. Auch wenn die Person schon lange im Verband aktiv ist, wird sie Zeit und Unterstützung brauchen, sich in der neuen Rolle einzuleben. Vor allem die erfahrenen Vorstandsmitglieder können eine große Hilfe sein. Hier ein paar Ideen, um den Einstieg leichter zu gestalten:
- Checklisten: Vielleicht findet ihr als amtierender Vorstand Zeit, eine Onboarding-Checkliste für neue Vorstandsmitglieder vorzubereiten. Was hat euch beim Einstieg geholfen? Was habt ihr vermisst?
- Buddy-System: Ein Vorstandsmitglied begleitet die neue Person in der Anfangszeit als „Buddy“, ist also feste Ansprechperson, beantwortet alle Fragen, erste Termine werden zu zweit erledigt, usw.
- Gemeinsamer Start: Bei einer neuen Zusammensetzung des Vorstands müssen Aufgaben neu verteilt werden. Ihr müsst vor allem aber auch über eure Erwartungen an eure Arbeit und aneinander sowie über eure Pläne und Zielsetzungen für den Verband sprechen. Nehmt euch dafür Zeit, am besten bei einer Vorstandsklausur in den ersten Wochen nach der Wahl.
- Achtsam sein: Plant bei den ersten Sitzungen als neuer Vorstand mehr Zeit ein für Fragen. Achtet auch auf eure Sprache: Sind alle „Vokabeln“ bekannt? Macht ganz deutlich, dass jede Frage in Ordnung ist.
- Fort- und Weiterbildungen
Der Einstieg neuer Vorstandsmitglieder kann auch erleichtert werden, wenn diese schon vor der Wahl die Möglichkeit hatten, in die Vorstandsarbeit „reinzuschnuppern“. Im Landesjugendrings ist es möglich, vor der Wahl an einer Vorstandssitzung teilzunehmen. Andere Formate könnten sein, die Vorstandsarbeit für einige Wochen zu begleiten und auch bei bestimmten Terminen dabei zu sein, oder als amtierender Vorstand Gesprächsangebote zu machen.
Der Abschnitt "Vorstandsarbeit" zum Download:
Die Förderung der Jugendverbandsarbeit ist eine wichtige Grundlage für eure Projekte und Aktivitäten. Hier findet ihr Infos zur regulären Jugendverbandsförderung sowie Tipps zu weiteren Fördermöglichkeiten.
- Welche Voraussetzungen müssen Jugendverbände für eine Förderung erfüllen?
Die Arbeit von Jugendverbänden hat eine gesetzliche Grundlage. Sie ist im Sozialgesetzbuch VIII in § 12 geregelt.
Junge Menschen haben ein Recht auf Angebote, die sich nach ihren Interessen richten und die sie selber gestalten können. Deshalb bekommen Jugendverbände, in denen junge Menschen zusammenkommen, öffentliche Fördermittel, also Geld vom Staat, um Angebote der Jugendarbeit zu machen.
Was alles unter Jugendarbeit zu verstehen ist, ist ebenfalls im Sozialgesetzbuch VIII geregelt. Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören außerschulische Jugendbildung, Sport- und Freizeitangebote, arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, internationale Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung (also zum Beispiel Ferienfreizeiten) und Jugendberatung. Der Landesjugendring Hamburg hat eine gute Zusammenfassung erstellt, was sich alles hinter diesen Schlagworten verbirgt.
Welche Voraussetzungen landesweit tätige Jugendverbände außerdem erfüllen müssen, um eine staatliche Förderung zu erhalten, ist in den jeweiligen Bundesländern geregelt. Im nächsten Abschnitt steht, welche Fördervoraussetzungen in Berlin gelten.
- Informationen zur Förderung der Jugendverbandsarbeit in Berlin
Im Sozialgesetzbuch VIII ist geregelt, dass Jugendverbände zu fördern sind, und welche Voraussetzungen sie dafür erfüllen müssen. In den jeweiligen Bundesländern werden diese Voraussetzungen nochmals in Förderrichtlinien konkretisiert.
Nach der Förderrichtlinie für Berliner Jugendverbände kann ein Jugendverband gefördert werden, wenn
- er als Träger der freien Jugendhilfe anerkannt ist,
- er landesweit tätig ist,
- Satzung und pädagogische Praxis demokratische Strukturen aufweisen und somit die Selbstbestimmung von jungen Menschen ermöglichen,
- es mindestens 300 Mitglieder gibt,
- in mindestens 5 Berliner Bezirken öffentlich bekannte Treffpunkte vorhanden sind,
- eigenständig über die Finanzen verfügt wird,
- ein Weisungsrecht des Vorstands gegenüber den Mitarbeiter* innen besteht,
- er in mindestens 3 außerverbandlichen Gremien die Interessen junger Menschen vertritt (bspw. im Landesjugendring oder einem Jugendhilfeausschuss),
- seine Arbeit auf Dauer angelegt ist.
Jugendverbände, die diese Kriterien erfüllen, können einen Antrag auf Jugendverbandsförderung stellen und eine „Einstiegsförderung“ von 2.000,- EUR erhalten. Eine höhere Förderung erhalten Jugendverbände je nachdem, wie viele Angebote sie machen. Mit den Angeboten erreichen sie sogenannte „Leistungsstufen“, die die Höhe ihrer Förderung bestimmen. Gezählt werden dafür die Anzahl der aktuell gültigen Juleicas im Verband und die durchgeführten Teilnahmetage bei Kursen, Ferienfreizeiten oder Internationalen Begegnungen. Es wird dabei immer jeweils der Durchschnitt aus den vorvergangenen 3 Jahren genommen, um die jeweilige Leistungsstufe zu ermitteln. Um eine Förderung zu erhalten, die über der „Einstiegsförderung“ liegt, muss ein Jugendverband mindestens Stufe 1 bei den Juleicas und mindestens Stufe 1 in einem weiteren Angebotsbereich erreichen.
Der Landesjugendring vergibt im Auftrag des Landes Berlin die Fördermittel an die Berliner Jugendverbände. Er prüft die Anträge und Verwendungsnachweise und berät die Jugendverbände. Wenn ihr Fragen zur Förderung habt, könnt ihr euch jederzeit an die Mitarbeiter*innen der Zentralstelle in der Geschäftsstelle des Landesjugendrings wenden.
- Sinnvoll bis notwendig: Anerkennung nach §75 SGB VIII
Eine Zugangsvoraussetzung für viele Förderungen ist die Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe. Das ist zum Beispiel Voraussetzung, um die reguläre Jugendverbandsförderung beantragen zu können, aber auch, um Juleica-Träger zu werden.
Die Anerkennung als freier Träger erfolgt in Berlin durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie. Auf der Website gibt es die Grundsätze für die Anerkennung, in der auch aufgelistet wird, was alles zu einem Antrag gehört. Dort sind auch die Kontaktdaten bei Fragen hinterlegt.
- Andere Möglichkeiten zur Finanzierung eurer Arbeit
Jugendverbände finanzieren ihre Arbeit auch über andere bzw. zusätzliche Wege, nämlich durch
- Spenden
- Mitgliedsbeiträge
- Teilnahmebeiträge bei bestimmten Angeboten wie Ferienfreizeiten oder Internationalen Begegnungen
- Projektförderungen
Jugendverbände können sich jederzeit an den Landesjugendring wenden, wenn sie Fragen zur Förderung haben. Der Landesjugendring berät seine Mitglieder sowohl zur regulären Jugendverbandsförderung als auch zur Frage, wie ein Projektantrag aussehen sollte.
Auf der Website des Landesjugendrings gibt es auch eine Übersicht über Fördermöglichkeiten.
Der Abschnitt "Förderung" zum Download:
Was gehört zu einem Jugendverband? Wie funktioniert er? In diesem Abschnitt findet ihr wichtige Infos zu Formalia, zur Gremienarbeit und weiteren Verbandsstrukturen. Außerdem geht es darum, wie ihr euren Verband zu einem sicheren und offenen Ort machen könnt, und es gibt Hinweise, wie ihr Barrieren identifizieren und abbauen könnt.
- Satzung & Geschäftsordnung
Die meisten Jugendverbände haben sich als Vereine konstituiert. Ein Verein braucht eine Satzung. In dieser ist geregelt, was die Ziele und die Schwerpunkte des Vereins sind, wie der Verein aufgebaut ist und wie die Gremien gestaltet sind, also wie im Verein Entscheidungen getroffen werden.
Manche Vereine haben eine Geschäftsordnung. Dazu ist ein Verein nicht verpflichtet, weil die gesetzlichen Anforderungen an einen Verein in der Satzung geregelt sein müssen. Es kann aber sinnvoll sein, eine Geschäftsordnung als Ergänzung zur Satzung zu haben. In ihr werden interne Verbandsregeln formuliert, und auch organisatorische Abläufe werden in einer Geschäftsordnung detaillierter geregelt als in einer Satzung. Zum Beispiel würde in einer Satzung stehen, ob ein Mitgliedsbeitrag erhoben wird. Alle Details dazu (Beitragshöhe, Ermäßigungen, Zahlungsmodalitäten) wären in der Geschäftsordnung geregelt.
- Vereinseintragung, Gemeinnützigkeit & Anerkennung als freier Träger
Vereinseintragung
Grundsätzlich muss sich ein Verein nicht zwingend eintragen lassen. Eine Eintragung ins Vereinsregister bringt aber deutliche Vorteile mit sich:- Nur ein eingetragener Verein ist eine eigenständige juristische Person. Das ist zum Beispiel in den allermeisten Fällen Voraussetzung, um eine Förderung zu beantragen.
- In der Regel haftet bei einem eingetragenen Verein der Verein, nicht die Mitglieder oder der Vorstand.
- Gemeinnützigkeit: Ein eingetragener Verein erhält deutlich leichter den Status der Gemeinnützigkeit.
Wenn euer Verein eingetragen ist, dann denkt daran, nach jeder Vorstandswahl das zuständige Amtsgericht über die neuen und die ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder oder über Satzungsänderungen zu informieren.
Gemeinnützigkeit
Die Gemeinnützigkeit ist die Voraussetzung dafür, dass euer Verein keine Körperschaftsteuer auf Einnahmen zahlen muss. Über die Gemeinnützigkeit entscheidet das Finanzamt. Wenn ihr gemeinnützig seid, müsst ihr alle drei Jahre eine Steuererklärung machen und dem Finanzamt Tätigkeitsberichte einreichen.Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe nach §75 SGB VIII
Eine Zugangsvoraussetzung für viele Förderungen ist die Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe. Das ist zum Beispiel Voraussetzung, um die reguläre Jugendverbandsförderung beantragen zu können, aber auch, um Juleica-Träger zu werden. Die Anerkennung als freier Träger erfolgt in Berlin durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie. Auf der Website gibt es die Grundsätze für die Anerkennung, in der auch aufgelistet wird, was alles zu einem Antrag gehört. Dort sind auch die Kontaktdaten bei Fragen hinterlegt.- Gremienarbeit im Verband
Wie in eurem Verband Entscheidungen getroffen werden, ist in der Satzung geregelt. Dort ist festgehalten, welche Gremien es gibt und wie sie sich organisieren. Jeder Verein hat mindestens zwei Gremien, die Mitgliederversammlung und den Vorstand.
Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung ist das höchste beschlussfassende Gremium eines Vereins. Hier können alle Mitglieder ihre Rechte ausüben. Zu den Aufgaben der Mitgliederversammlung gehören unter anderem- Wahl des Vorstands
- Änderungen der Satzung
- Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresabrechnung
- Entlastung des Vorstands
- Beschluss des Haushalts
Außerdem ist die Mitgliederversammlung der Ort, an dem ihr euch auch über die Arbeit des Verbands austauschen könnt, an dem Pläne für die Zukunft entstehen und Positionen beschlossen werden.
Eine Satzung muss eine Regelung enthalten, wie und wann die Mitgliederversammlung einberufen wird.Vorstand
Der Vorstand ist das ausführende Organ des Vereins. Er wird von der Mitgliederversammlung gewählt. Zu seinen Aufgaben gehören unter anderem,- die Ziele umzusetzen, die die Mitgliederversammlung für den Verband beschlossen hat,
- den Verein nach außen zu vertreten,
- Verantwortung für die Organisation und Finanzen zu tragen,
Ein Verein ist nach § 26 BGB dazu verpflichtet, einen Vorstand zu haben, der aus mindestens einer Person besteht.
Mehr Informationen zum Thema Vorstand gibt es im Abschnitt „Vorstandsarbeit“.
- Ämter, AGs, Positionen: Welche Positionen gibt es noch?
Kassenprüfer*innen (auch Revisor*innen)
Dieses Amt ist nicht gesetzlich vorgeschrieben, viele Verbände haben allerdings in ihrer Satzung geregelt, dass es eine*n Kassenprüfer*in im Verband gibt. Das ist in der Praxis üblich und sinnvoll. Es gehört zu den Aufgaben der Mitgliederversammlung, die Finanzen des Vereins zu kontrollieren. Kassenprüfer*innen erleichtern diese Aufgabe: Sie kontrollieren die Finanzen und legen der Mitgliederversammlung einen Bericht vor.
Kassenprüfer*innen werden von der Mitgliederversammlung gewählt. Das Amt können auch mehrere Personen im Team übernehmen.Ausschüsse
Ausschüsse unterstützen den Vorstand bei bestimmten Themen (z.B. Finanzen, Veranstaltungen, andere spezifische Themen). Sie sind nicht vorgeschrieben, können aber helfen, die Arbeit im Verband zu strukturieren.Kommissionen
Eine Kommission wird für eine bestimmte Aufgabe oder Fragestellung eingerichtet. Sie setzt sich aus mehreren Personen zusammen, die über Expertise zu dem jeweiligen Thema verfügen. Sie wird oft von einem Gremium eingesetzt, um Entscheidungen vorzubereiten, Empfehlungen zu geben oder Arbeits- und Themenbereiche weiterzuentwickeln. Kommissionen können zeitlich begrenzt, aber auch dauerhaft eingesetzt werden.Arbeitsgruppen
Arbeitsgruppen werden gegründet, um eine bestimmte Aufgabe umzusetzen. Ist diese erfüllt, werden sie in der Regel wieder aufgelöst.- Wie werden Jugendverbände zu sicheren Orten?
In Jugendverbänden tragen wir dafür Verantwortung, dass es den Kindern und Jugendlichen gut geht und der Jugendverband für sie ein sicherer Ort ist. Das geschieht jedoch nicht von allein. Ein Jugendverband muss für die notwendigen Strukturen sorgen. Schutz- und Awareness-Konzepte spielen in der Kinder- und Jugendarbeit eine besonders wichtige Rolle.
Schutz vor sexualisierter Gewalt
Ehrenamtliche und berufliche Mitarbeiter*innen in den Jugendverbänden sind unbewusst oder bewusst in Kontakt mit Opfern von Vernachlässigung, Misshandlung und sexualisierter Gewalt. Auch wenn sexualisierte Gewalt zu 90% in Familienzusammenhängen stattfindet, müssen wir uns als Jugendverbände darüber hinaus der Tatsache stellen, dass Täter*innen strategisch vorgehen und sich auch an unseren Vertrauensorten für Kinder und Jugendliche befinden können.
Die meisten Jugendverbände haben ein Schutzkonzept, in dem klar dargestellt ist, was bei einem (Verdachts-)Fall von Kindeswohlgefährdung zu tun ist. Ein Schutzkonzept beinhaltet sowohl Präventionsmaßnahmen als auch einen aufgeschlüsselten Interventionsprozess. Vor allem sind auch Ansprechpersonen und die ersten Schritte zur Intervention klar benannt und geben den Ehrenamtlichen Sicherheit. Das Schutzkonzept müssen alle Aktiven kennen!
Die Broschüre „Kinder- und Jugendschutz in Berlin“ des Landesjugendring informiert zum Thema und beinhaltet auch Hinweise zur Entwicklung eines Schutzkonzepts.Erweitertes Führungszeugnis
In eurem Jugendverband werdet ihr eine Regelung haben, welche Personen ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen müssen. Alle, die in der Kinder- und Jugendhilfe haupt- oder nebenberuflich tätig sind, sind dazu verpflichtet. Ehrenamtliche können dazu auch verpflichtet sein, allerdings ist die Pflicht abhängig von der Art, Intensität und Dauer des Kontakts zu Kindern und Jugendlichen. Ehrenamtliche erhalten das Führungszeugnis kostenlos. Der Landesjugendring informiert auf seiner Website ausführlich zum Thema Kinderschutz, insbesondere zur Frage, wie Jugendverbände Schutzkonzepte entwickeln können. Dort gibt es auch Infos zu Führungszeugnissen sowie eine Textvorlage für Jugendverbände, um Gebührenfreiheit für das erweiterte Führungszeugnis zu beantragen.Awareness-Konzept
Ein Awareness-Konzept sorgt dafür, dass alle respektvoll und sicher miteinander umgehen. Es hilft, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich jede*r wohlfühlen kann. Dazu gehören klare Regeln, Präventionsmaßnahmen und Ansprechpersonen, an die man sich bei Konflikten, bei Fällen von Diskriminierung, Grenzverletzungen, Fällen von Gewalt oder anderen Situationen wenden kann. Awareness-Konzepte werden oft im Rahmen von Veranstaltungen angewendet, begleitet von einem Awareness-Team oder einer Awareness-Person. Ein Awareness-Konzept kann sich aber auch an die Strukturen eines Verbands richten.- Wie bauen wir Barrieren ab?
Nicht immer erreichen Jugendverbände mit ihren Angeboten alle, die sie erreichen wollen. Es gibt verschiedene Gründe, warum einige junge Menschen (zunächst) keinen Zugang in die Angebote der Jugendverbände finden.
Nehmt euch am besten Zeit dazu, die Strukturen und den Alltag in eurem Verband genauer anzuschauen. Welche Barrieren bestehen in eurem Verband?
- Gibt es finanzielle Barrieren? Kosten die Angebote etwas? Gibt es Mitgliedsbeiträge? Gibt es Regelungen für Kinder und Jugendliche, die sich die Beiträge oder Teilnahmebeiträge nicht leisten können?
- Gibt es sprachliche Barrieren?
- Gibt es Barrieren aufgrund der Orte, an denen die Angebote stattfinden? Wie barrierefrei sind die Orte? Sind die Orte mit dem ÖPNV zu erreichen? Ist eine Begleitung zu den Veranstaltungsorten möglich?
- Gibt es mehrheitlich Angebote, die sich nur an unsere Mitglieder richten?
- Welche Strukturen oder unbewussten Vorurteile im Verband könnten Barrieren verstärken?
- Gibt es Safer Spaces? Gelingt es uns zu zeigen, dass unser Verband ein sicherer Ort ist?
Das sind natürlich nur einige Beispielfragen. Hilfreich bei dieser Auseinandersetzung können Selbstchecks sein. In einem Padlet haben wir Informationen zum Thema Diversität und Inklusion in der Jugend(verbands)arbeit zusammengefasst. Neben Beispielen zu Projekten, Angeboten und Praxiserfahrungen aus Berliner Jugendverbänden und auch bundesweit gibt es zudem Selbstchecks, Tipps für Arbeitshilfen, Methodensammlungen und weitere Publikationen, Infos für die Öffentlichkeitsarbeit, für Veranstaltungen und Hinweise zu Fortbildungen und Beratungsangeboten.
Das Landesjugendring-Projekt „Zusammen SEIN“ unterstützt Jugendverbände darin, Barrieren im Verband und in den Angeboten abzubauen. Ziel ist, dass mehr junge Menschen mit Behinderungen in den Verbänden mitmachen können. Auf der Website des Projekts "Zusammen SEIN" gibt es viele Informationen und Materialien zum Thema.
Der Abschnitt "Jugendverbände und ihre Strukturen" zum Download:
Jugendverbände vertreten die Interessen junger Menschen und bringen ihre Perspektiven in Entscheidungsprozesse ein. Dazu ist es wichtig, in politischen Gremien mitzuwirken. Zwei Beispiele hierfür sind die aktive Mitarbeit im Landesjugendring oder im Jugendhilfeausschuss. Hier erfahrt ihr mehr dazu.
- Jugendringe und ihre Aufgaben
Jugendringe sind Zusammenschlüsse von Jugendverbänden auf kommunaler, Landes- und Bundesebene. Sie unterstützen Jugendverbände in ihrer Arbeit, fördern die Vernetzung und Kooperation zwischen den Verbänden und vertreten die Interessen junger Menschen gegenüber Politik, Verwaltung und Gesellschaft.
Zu den Aufgaben von Jugendringen gehören unter anderem
- Interessenvertretung und Förderung von Mitbestimmung und Selbstorganisation junger Menschen
- Förderung und Unterstützung der Jugendverbandsarbeit durch Vernetzung, Beratung, Veranstaltungen und gemeinsame Projekte
- Fachveranstaltungen, Fortbildungen, Projekte
- Öffentlichkeitsarbeit
- Der Landesjugendring Berlin
Im Landesjugendring Berlin sind 37 Jugendverbände und Bezirksjugendringe zusammengeschlossen. Der Landesjugendring setzt sich dafür ein, dass alle Kinder und Jugendlichen unsere demokratische Gesellschaft mitgestalten können.
Das sind die Aufgaben des Landesjugendring Berlin:
- Interessen von Kindern und Jugendlichen vertreten und jugendpolitisch Stellung beziehen
- Jugendverbände vernetzen, beraten und unterstützen
- Projekte durchführen
- Fachveranstaltungen und Weiterbildungen anbieten
- Fördergelder des Landes Berlin an Jugendverbände weiterleiten
Mitmachen im Landesjugendring
Wir arbeiten in unterschiedlichen demokratischen Gremien, die Vertreter*innen aus Berliner Jugendverbänden gestalten. Dazu gehören die Mitgliederversammlung, der Hauptausschuss, der Vorstand sowie Kommissionen und Arbeitsgemeinschaften.Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung ist das höchste beschlussfassende Gremium im Landesjugendring Berlin. Einmal im Jahr treffen sich Delegierte aus allen Mitgliedsverbänden, um über inhaltliche Schwerpunkte zu beraten, den Haushalt zu beschließen und alle zwei Jahre den Vorstand zu wählen. Die Mitgliederversammlung kann mit Anträgen aus den Jugendverbänden außerdem Beschlüsse fassen, die die inhaltlichen Schwerpunkte der jugendpolitischen Arbeit des Landesjugendring mitbestimmen.Hauptausschuss
Der Hauptausschuss des Landesjugendring trifft sich viermal im Jahr und fällt zwischen den jährlichen Mitgliederversammlungen Entscheidungen. Jeder Mitgliedsverband ist darin mit einer Stimme vertreten. Der Hauptausschuss wählt die Außenvertreter*innen des Landesjugendring und setzt Kommissionen ein, die den Vorstand und den Hauptausschuss beraten.Vorstand
Der Landesjugendring-Vorstand wird alle zwei Jahre von der Mitgliederversammlung gewählt. Der Vorstand setzt die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Hauptausschusses um. Zu den Aufgaben des Vorstands gehört, die jugendpolitische Interessensvertretung sowie die inhaltliche und organisatorische Entwicklung des Landesjugendring zu koordinieren. Der Vorstand trifft sich einmal im Monat.Außerdem gibt es im Landesjugendring Kommissionen und Arbeitsgemeinschaften, in denen Vertreter*innen der Jugendverbände zu bestimmten Themen zusammenarbeiten. Ein Beispiel ist die Kommission Juleica, die die fachliche, organisatorische und technische Weiterentwicklung der Jugendleiter_innen-Card gestaltet und begleitet. Sie ist immer offen für neue Engagierte, die sich einbringen wollen, um die Juleica besser zu machen.
Einen Überblick über unsere Arbeitsweise erhält man am besten in unserem Organigramm.
- Jugendhilfeausschüsse
Für die Jugendarbeit und Jugendhilfe sind in den Berliner Bezirken die Jugendämter zuständig. Das Jugendamt besteht aus zwei Teilen, dem Jugendhilfeausschuss und der Verwaltung des Jugendamts.
Jugendhilfeausschüsse sorgen dafür, dass junge Menschen und ihre Familien in der kommunalen Jugendhilfe Gehör finden und die Angebote der Jugendhilfe geplant, koordiniert und kontrolliert werden. Die Verwaltung setzt die Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses um.Der Jugendhilfeausschuss
- berät und entscheidet über alle wesentlichen Angelegenheiten der Jugendhilfe,
- ist für die örtliche Jugendhilfeplanung verantwortlich,
- sorgt für die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und freien Trägern der Jugendhilfe,
- überwacht die Arbeit des Jugendamtes und berät es in seiner fachlichen Ausrichtung,
- stellt sicher, dass Jugendverbände und junge Menschen bei Entscheidungen einbezogen werden, die sie betreffen.
Ein Jugendhilfeausschuss besteht aus zwei Gruppen,
- den stimmberechtigten Mitgliedern: Vertreter*innen aus Politik und Vertreter*innen der freien Träger der Jugendhilfe (z. B. Jugendverbände, Wohlfahrtsverbände)
- den beratenden Mitgliedern: Vertretungen von Schulen, der Kirchen, aus der Jugendhilfe angrenzenden Bereichen oder anderen.
Mitglied im Jugendhilfeausschuss können werden:
- gewählte Mitglieder eines kommunalen Gremiums
- Personen, die von einem freien Träger der Jugendhilfe vorgeschlagen werden
- Personen, die als beratendes Mitglied durch eine Institution entsandt werden
Der Abschnitt "Ab in die Außenvertretung" zum Download:
Emojis auf den Bildern auf dieser Seite: Designed by OpenMoji (openmoji.org). License: CC BY-SA 4.0